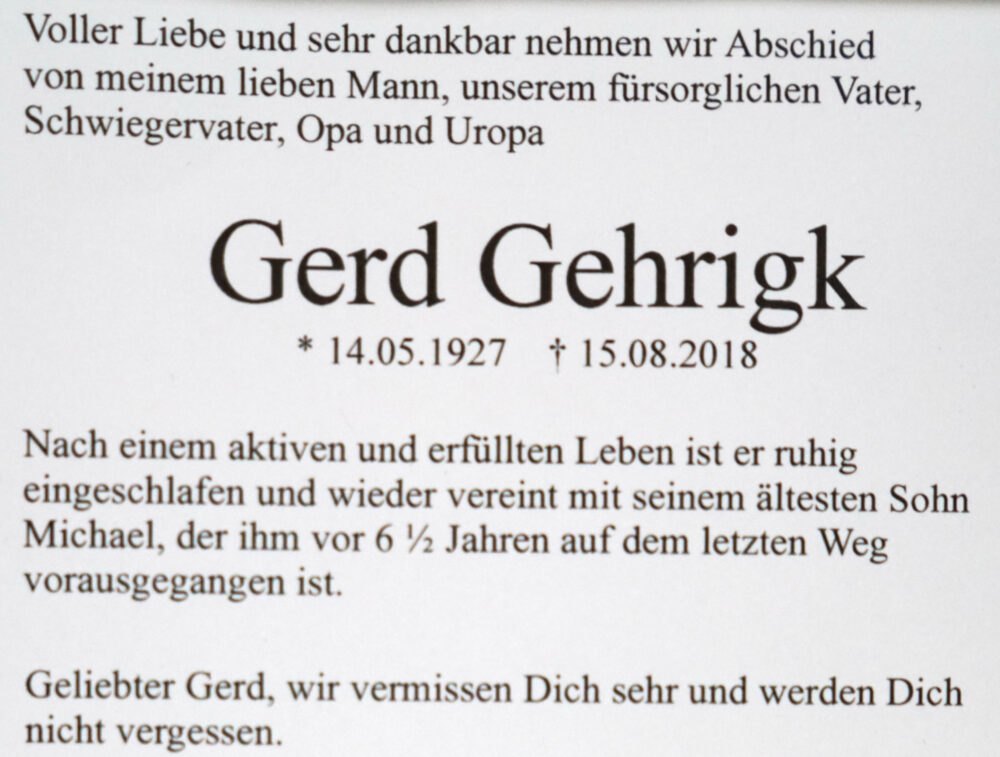02. September 2018
(Pompeji)
Salvatore hat uns angeboten, uns zum Bahnhof zu fahren. Wir sollen einfach Bescheid sagen, wenn wir soweit sind. Er sei ja da.
Vorher möchte ich unbedingt noch einen kleinen „Altar“ fotografieren, den jemand mitten im Hafen liebevoll gestaltet hat und pflegt.

Als ich die Kamera runter nehme, kommt Salvatore vorbei. Ganz der joviale, naive, neugierige, ein bisschen aufdringliche Tourist frage ich ihn leutselig, was es mit diesem Altar, … und möchte am liebsten abbrechen, denn sein Gesicht wird grau und leer. Meins wahrscheinlich auch. Er erklärt leise, dieser Altar sei für seinen Sohn. Der sei als kleiner Junge 1996 hier im Hafen ertrunken. Er habe gespielt, sich den Kopf gestoßen, sei bewusstlos geworden und ins Wasser gefallen. Mit allem, was ich habe zusätzlich zu den paar Brocken Italienisch, versuche ich ihm mein Mitgefühl auszudrücken. Wir sind beide verlegen. Er rettet sich damit, dass er ein paar trockene Blätter aus seinem Altar pickt. Ich stehe da …
Salvatores Angebot, uns mit seinem Auto zum Bahnhof zu bringen, wenn wir nach Pompeji aufbrechen, nehmen wir gerne an.

Als wir alle im Auto sitzen, hat sich längst das Leben wieder breitgemacht. Er surrt die Scheibe herunter, dreht das Radio voll auf und macht dem Hafen und verschiedenen Menschen hier seine Aufwartung. Wirft Rufe zur anderen Straßenseite. Bleibt kurz stehen um ein paar Worte mit einer Person im Eingang einer Bar zu wechseln. Dreht das Radio leise, dreht es wieder laut, lässt uns am Bahnhof aussteigen und hat sich so schnell umgedreht und wieder in Fahrt gesetzt, dass es nicht möglich gewesen wäre, ihm Geld zu geben für seine Hilfe. Ich bin sicher, er hat gewusst, dass ich mich frage, ob ich das nicht eigentlich müsste und wollte es unbedingt vermeiden.
Ob es die Vorstellung ist, dass diese Stadt mitten aus dem Leben heraus vom Vesuv brutal auf „Stop“ gestellt wurde und wir nun sie ansehen, als wäre es gerade passiert? Oder ist es die Tatsache, dass so Vieles so gut erhalten ist, dass man hier wirklich städtisches Leben vor 2000 Jahren fühlen kann? In allen Facetten.

Z.B. „Straßenverkehr“. Ich höre geradezu das Rumpeln der Holzräder auf diesem Pflaster. Wir rätseln lange, was diese Erhöhungen in dem Straßenpflaster sollen. Sie wirken wie ein steinerner Zebrastreifen. Schließlich einigen wir uns darauf, dass sie dazu dienten die Straße zu überqueren ohne sich in der Kloake, die sie ebenfalls war, die Füße zu versauen.
Z.B. kleine Läden entlang der Straßen. In manche der gut erhaltenen „Theken“ sind in Reihe und Glied Tongefäße eingelassen, von denen man nicht weiß, welche Funktion sie hatten.
Z.B. der Wellness-Tempel, die Arena, die schicke Villa am Stadtrand, die kleinen Wohnungen in Nebenstraßen, die Verwaltungsgebäude. Alles gestern noch belebt und in Gebrauch.
Uns alle nimmt dieses Gelände mit auf eine berührende Zeitreise. Na ja, nicht ganz alle. Manche treiben auch hier und da morbiden Schabernack.

„Uns alle“ sind Hunderte von Besuchern, deren Gewimmel das Staunen manchmal etwas zerfleddert.

Andererseits ist es schön. Uns alle verbindet offenbar etwas. Vielleicht die Ehrfurcht vor der wirklich gelebten Geschichte. Und es ist schön, weil heute der Tag ist, an dem es keinen Eintritt kostet, dieses Gelände zu besuchen. Ein Geschenk für „Uns alle“.
Bei der Rückkehr führt uns unser Fußweg wieder durch die città von der traurigen Gestalt.
Morgen wird uns der Weg wieder von ihr weg führen. Wir werden sie mit Sympathie in Erinnerung behalten, diesen Ort, von dem wir erst dachten, sein malades Dasein würde uns zusätzlich betrüben.
Jetzt dagegen erwarten wir es ganz anders. Uns erwartet italienische Postkarten-Idylle par excellence. Capri. Amalfi. Was für klangvolle Namen, die jedem winterlichen blassgesichtigen Italien-Fan in unserem Heimatland Seufzer des Entzückens entlocken.