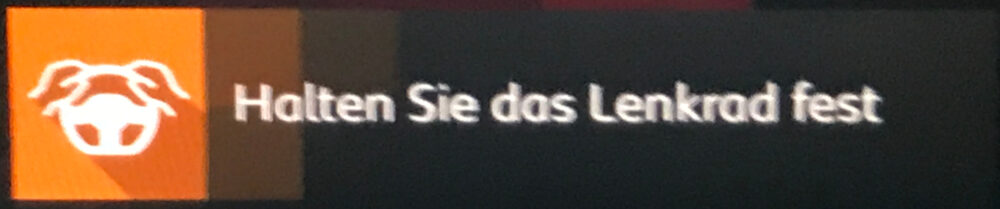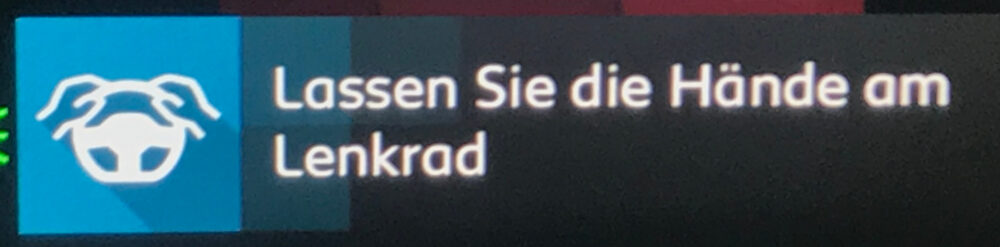Abschied aus Anderland
Nun wird sie also bald auch Anderland verlassen. Ihr Bett ist schon im Zug. In einem menschenleeren Bahnhof mit nur einem Gleis. Auf dem Bahnsteig: Ich. Ratlos. Fragend. Traurig.
Ich sehe sie an, – dort hinter den von Dunst und Staub eines langen Lebens trüb gewordenen Scheiben. Bin unentschlossen. Nochmal rein zu ihr? Ihr die Hand reichen? Hab keine Angst, ich bin bei dir. Oder lieber am Rand bleiben? Den Zug abfahren lassen? Ihn nicht aufhalten? Manchmal fange ich ihren Blick. Freue mich, wenn ihre Augen in plötzlicher Heiterkeit aufklaren und sanfte Lächelfalten über ihr Gesicht verteilen. Ganz langsam. Auf dass ich ja jede einzelne mitbekäme. Stolpere aus dieser Wonne heraus und merke auf, wenn sie kurz danach plötzlich ihren Kopf abwendet, als fiele ihr etwas ein, dem sie nun ungestört ihre Aufmerksamkeit widmen müsse.
Unablässig brummen Gedankenkreisel mir durchs Gemüt. Ihre Hand nehmen? Ihren Blick wieder zurückholen? Etwas sagen? Ihr etwas erzählen? Gute Laune verbreiten? Meine Trauer zeigen? Im Hintergrund bleiben? Ganz rausgehen? Was wäre jetzt gut, richtig, sinnvoll? Und keine Idee, wonach ich das beurteilen könnte.
Irgendwann erinnere ich mich: Haben wir das nicht trainiert? In all der Zeit, die sie nun schon in der Demenz lebt? Habe ich nicht geübt, das Leben mit ihr zu lassen, wie es ist. Und wie es nicht ist. Nichts zu wollen. Nichts zu müssen. Einfach da zu sein und sie zu beobachten. Und dieses Leben. Und mich.
Und dann sehe ich sie an. Lasse fragende Gedanken, was jetzt richtig wäre zu tun, einfach weiterziehen. Wie beim Meditieren. Sehe kleinste Veränderungen in ihrem Blick. Registriere, wenn ich das Gefühl habe, sie schaute mich an. Oder sie schaute an mir vorbei, um mich herum ins Weite und zugleich nach innen. Nehme meinen ganzen Mut zusammen und höre ihrem Husten zu. An dem ich nichts ändern kann. Und so gerne würde. Von dem ich phantasiere, es müsse sie quälen. Was sie aber gar nicht zum Ausdruck bringt. Sie wirkt eher, als würde sie es hinnehmen, wie man das Leben eben so hinnimmt. Dieses Husten, das gerade allmählich kraftloser wird, abflaut zu einem müder werdenden sanft simmernden Schrundeln ihres Atems, das unablässig den Schleim in ihren Bronchen umwälzt. Dann plötzlich wieder ein Aufbäumen des Hustens, an dessen Ende manchmal ein hellstimmig singendes „Ho, ho, ho, ho“ die Rutschbahn der Erleichterung hinabhüpft. Dann sehe ich sie förmlich vor mir, wie sie die Hände an der vorne zusammengeknuddelten Schürze abtrocknet und anschließend mit einem Handrücken eine Strähne aus der Stirn wischt.
Dies Da-sein, ohne etwas zu wollen, stattdessen meiner Intuition zu vertrauen, schenkt mir manchmal Momente von tiefer Rührung. Einmal hat sie die Augen geschlossen, schläft aber nicht. Sie singt immer wieder einen Ton vor sich hin. Unterbricht ihn bei einem Hustenschub. Wartet nach seinem Ende. Setzt exakt denselben Ton wieder an. Er ist zu mild, um ihn klagend nennen zu können. Er klingt eher wie unbegleitet aus der Litanei des Lebens geschlüpft. Beim dritten Mal singe ich ihn mit. Einfach so. Ich spüre, wie ich die Stimmbänder anspannen und den Atem beisammenhalten muss. Ich habe die Phantasie, dass dieses Zusammenhalten ihren Husten vielleicht noch anschubst. Also singe ich den nächsten Ton tiefer. Mit deutlich mehr Hauchen und deutlich weniger Stimmbandspannung. Und sie macht tatsächlich genau diesen Ton nach! Wieder einen Ton tiefer. Mehr Hauchen. Sie folgt mir wirklich hinab. Am Ende bleibt bei uns beiden nur noch ein Hauchen. Ihr Atem ist flach. Zu flach um das lauernde Husten zu wecken. Tiefe Ruhe breitet sich aus. Auch ihr höre ich zu. Lasse den Gedanken, wie es sich wohl anfühlt, wenn der nächste Atemzug der letzte wäre, einfach weiterziehen. Ich meditiere ja. Ich muss nichts.
Manchmal hebt sie plötzlich ganz langsam ihren rechten Arm, so weit, bis er leicht federnd schräg von ihr weg in den Raum ragt. Dann schließen sich Daumen und Zeigefinger zu einem Oval. Und das lässt sie langsam kreisen, als würde sie ein Orchester bei einem sehr langsamen, wiegenden Adagio dirigieren. Einmal reiche ich ihr mit einem Löffel Grießbrei. Ganz selten nimmt sie etwas, meistens nicht. In meiner linken Hand der Teller, in meiner rechten Hand der Löffel. Beide Unterarme auf der Bettumrandung. Sie sind zu schwer, um sie bei diesem langwierigen Unterfangen frei hochzuhalten. Wieder bewegt sich ihr rechter Arm aufwärts, beginnt sein Dirigat. Und während ich ein weiteres Mal den Löffel auf ihren Mund zu bewege, sehe ich im Augenwinkel, wie sich plötzlich der Arm auf meinen Kopf zu bewegt. Wie von selbst kommt mein Kopf ihr entgegen. Mit eigentlich kaum möglicher Entschlossenheit schnappen plötzlich Daumen und Zeigefinger meine Nase. Knabbern an ihr herum. Unwillkürlich muss ich lauthals lachen. Wieder verteilen ihre Augen dieses sonnige Lächeln über ihr Gesicht.
Ein weiteres Mal sind – schlaflos – ihre Lider geschlossen. Ihr Mund zermalt die Trockenheit. Ich bewege trotz der geschlossenen Lider den Trinkbecher auf ihren Mund zu. Und wirklich: Er öffnet sich wie auf ein geheimes Signal hin ganz kurz, bevor der Becher die Lippen berührt. Obwohl sie doch eigentlich gar nicht wissen kann, dass der Becher jetzt da ist. Lässt den Schnabel der Tasse hinein, umschließt ihn und signalisiert mit einer minimalen Bewegung im Mundwinkel, dass ich ihn wieder herausnehmen kann. Ein filigranes Zusammenspiel von Geben und Nehmen. Ohne Aufwand. Ohne Plan. Wie ein Regentropfen, der von einem Blatt gleitet, am Stamm entlang. Immer weiter. Bis zu der Stelle, wo eine Wurzel ihn vielleicht gerade braucht.
Zum Abschied verneige ich mich immer. Buchstäblich. Mag sie es – vielleicht mit einer kleinen Genugtuung – nehmen als den freundlichen Diener eines wohlerzogenen Jungen.
Dann sage ich „Tschüss. Hab einen guten Schlaf.“
„Bis morgen“, sage ich nicht.
Obwohl ich insgeheim hoffe, dass ihr Zug auch morgen noch auf dem Gleis steht.